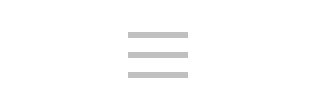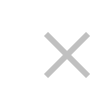|
|
Eine Sage vom Geben und Nehmen und vom rechten Augenblick
Wie alte Chroniken berichten, zeigte sich in der Johannisnacht 1590 dem Ratsförster Kajetan Schreier aus der Stadt Löbau in der Oberlausitz eine eindrückliche Erscheinung, voll Duft, Klang und Licht, eine Wunderblume. Während der Jäger zuvor noch zielsicher einen Hirsch erlegte, war er nun bald so stark von seinem Erleben gefangen genommen, dass ihm die Sinne zu schwinden begannen. Wohl wollte er auf die Blume zugehen, doch ging er in die Irre. Mit dem Schlage der Mitternachtsglocke, welche aus der am Fusse des Berges gelegenen Stadt heraufscholl, blitze und krachte es heftig, und die Blume war nicht mehr da. Vergeblich suchte er am folgenden Morgen, die Blume wiederzufinden.
Der Jäger tritt uns als ein von seinem Erlebnis Ergriffener entgegen. Anders, als wir es von anderen Sagen gleichen Sujets kennen, bleibt bei den aus Löbau berichteten Ereignissen alles in der Schwebe: Kajetan Schreier findet nicht das grosse Glück, er wird aber auch nicht unglücklich. Vielmehr scheint ihn die Wunderblume in jener Mittsommernacht als einen Suchenden zurückgelassen zu haben.
Der Vortrag will einladen, den Zusammenhängen nachzulauschen zwischen dem «Licht der Natur» und dem «Licht des Menschen», und so die Gedanken Paracelsus’ weiterzuführen.
Paracelsus schrieb: «... Denn die Natur gibt ein Licht, wodurch man sie erkennen kann aus ihrem eigenen Schein. Aber im Menschen ist auch ein Licht ausser jenem Licht, das aus der Natur herstammt: Es ist nämlich das Licht, durch das der Mensch übernatürliche Dinge erfährt, lernt und ergründet. Diejenigen, die im Licht der Natur suchen, die reden von der Natur, diejenigen, die im Licht des Menschen suchen, die reden von einem Bereich über der Natur.» (Paracelsus, Liber de nymphis, S. 8).
Es ist und bleibt ein Geben und Nehmen, was uns mit all unserer Umwelt verbindet, mit den Menschen ebenso wie mit aller belebter und unbelebter Natur. Auf unsere Haltung kommt es an, auf Demut, ein unpopulärer Begriff freilich. Mit einer solchen Einstellung können wir es vielleicht besser ertragen, wenn unsere Begriffe nicht ausreichen, das Geschaute in Worte zu bringen, oder wenn wir wirklich nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist.
Kurz vor seinem Tode schrieb C.G. Jung hierzu: «Eigensinnig möchten wir die Zukunft nach unseren Vorstellungen gestalten. Wir entscheiden, als wenn wir wüssten. Wir wissen nur, was wir wissen, aber es gäbe sehr viel mehr, was wir wissen könnten, wenn wir nur aufhören wollten, auf dem zu beharren, was wir wissen. Der Traum würde uns ein Weiteres erzählen, darum verachten wir den Traum, und fahren fort, ad infinitum aufzulösen.
Was ist der grosse Traum? Er besteht aus den vielen kleinen Träumen und den vielen Akten der Demut und Unterwerfungen unter ihre Andeutungen. Er ist die Zukunft und das Bild der neuen Welt, die wir noch nicht verstehen. Wir können es nicht besser wissen als das Unbewusste und seine Andeutungen. Dort liegt eine Chance, das zu finden, was wir in der bewussten Welt vergeblich suchen. Wo sonst könnte es sein? Ich fürchte, ich finde nie die Sprache, diese einfachen Gedankengänge den Menschen meiner Zeit zu vermitteln.» (C.G. Jung, Brief an Sir Herbert Read, geschrieben am 2. Sept. 1960. Briefe, Bd. 3, S. 337).
Datum: Samstag, 31. Januar 2026
Beginn: 17.30 Uhr
Eintritt: Fr. 30; für StudentInnen,
Mitglieder und stat. Gäste frei
Tickets for LIVE-Zoom events can be booked from 14 days before the event. |